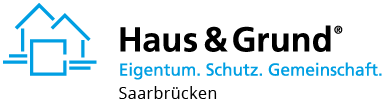Grubenwasser als Wärmequelle im Saarland

Foto: HAS Innova Rig
„Den größten Energiespeicher haben wir unter unseren Füßen – nämlich die Erdwärme. Der Wärmestrom aus dem Erdinneren entspricht etwa dem doppelten des Weltenergieverbrauchs.“ Thomas Neu, Bergbauingenieur und leidenschaftlicher Verfechter der Geothermie, wird nicht müde, auf diese Energiequelle hinzuweisen, „die uns vor allem beim umweltfreundlichen Heizen ein gutes Stück nach vorne bringen könnte. Sie ist preislich kalkulierbar und ständig verfügbar“. Thomas Neu war Gastredner beim diesjährigen Landesverbandstag des Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümerverbands (Haus & Grund) Saarland. Seit Jahrzehnten berät er mit seiner Ingenieurgesellschaft proG.E.O. Projekte, die die Nutzung von Geothermie zum Ziel haben – „allerdings bisher mit Schwerpunkt in Süddeutschland und Österreich“.
In seiner saarländischen Heimat hat das Thema öffentlich keine hohe Priorität, klagt Neu, obwohl Potenzial vorhanden sei. „Im Saarland steigt die Temperatur im Erdinnern pro hundert Meter Tiefe stellenweise um sechs Grad Celsius an, durchschnittlich sind es drei Grad“. In der Region südöstlich von Saarbrücken und im Norden des Landes entlang der Nahe vermute das Leibniz-Institut für Angewandte Geophysik (LIAG, Hannover) ein „hydrothermales Potenzial für mitteltiefe Geothermie (400 bis 1500 Meter) und für tiefe Geothermie (mehr als 1500 Meter)“. Hierbei wird heißes Wasser aus dem Untergrund genutzt, um beispielsweise ein Fernwärmenetz zu betreiben.
In diesen Regionen des Landes geht das LIAG zudem davon aus, dass dort auch die petrothermale Geothermie eine Rolle spielen könnte. Bei diesem Verfahren wird die Wärme des heißen Gesteins in Tiefen zwischen 2000 und 6000 Meter genutzt, um Wasser zu erhitzen, das bisher dort in künstlich vergrößerte Risse und Klüfte hineingepresst wird. Anschließend wird das bis zu 150 Grad heiße Wasser gesammelt und an die Erdoberfläche zurückgepumpt, wo es zum Heizen oder zur Stromerzeugung genutzt werden kann. In Geretsried (östlich des Starnberger Sees) wird derzeit eine solche Anlage nach einem Richtbohrtechnik nutzenden Konzept fertiggestellt. „Unter dem Ort herrschen ähnliche Verhältnisse wie in Teilen des Saarlands“, so Neu. Dort soll von der Oberfläche eingespeistes kaltes Wasser in 4500 Meter Tiefe durch ein Geflecht parallel verlaufender Schleifen (= Bohrungen) zirkulieren. Das Wasser wird dann vom etwa 160 Grad heißen Umgebungsgestein so stark erhitzt, dass es selbständig wieder nach oben steigt. Das kanadische Unternehmen Eavor betreue dieses Projekt. 200 bis 350 Millionen Euro soll die Anlage laut Kalkulation kosten, schreibt die „Süddeutsche Zeitung“. Der Europäische Innovationsfonds fördert das Projekt mit 91,6 Millionen Euro. Die Fernwärme könnte am Ende rund 30.000 Durchschnittshaushalte versorgen. „Sollte Geretsried in den nächsten Monaten erfolgreich sein, könnte Kontakt zu Eavor aufgenommen werden“, so Thomas Neu.
Doch zunächst muss das Saarland eine Datengrundlage schaffen, „die als Basis für eine Wärmeplanung dient“, sagt Thomas Neu. Andere Bundesländer wie Bayern, Sachsen oder Nordrhein- Westfalen (NRW) „haben solche Potenzialstudien bereits erstellt“. Im Saarland fehle es auch an Personal, um diese Vorhaben anzugehen. „Die Kapazität bei den beteiligten Ämtern müsse spürbar aufgestockt werden.“ Doch das Gegenteil passiere: „Der Geologische Dienst des Landes ist vor Jahren fast eingestellt worden.“ Am Geld sollte es nicht scheitern, so Neu. Denn solche Untersuchungen würden kräftig gefördert. Das Explorationsprogramm des Bundes unterstütze seismische Studien und Probebohrungen mit bis zu 50 Prozent der Kosten. Der Aufwand für die wissenschaftliche Begleitung würde zudem komplett übernommen.
„Viel Geld steht auch im Bundesförderprogramm für effiziente Wärme (BEW) zur Verfügung“, sagte der Geothermie-Experte. So werde der Neubau von Nah- und Fernwärmenetzen mit 40 Prozent (maximal 100 Millionen Euro) gefördert. Das gelte auch für Vorhaben mit dem Ziel, bei bestehenden Netzen fossile Energieträger – zum Beispiel Erdgas – durch Geothermie zu ersetzen. „Auch Machbarkeitsstudien werden mit 50 Prozent (höchstens zwei Millionen Euro) gefördert.“
Ein besonderer geothermische Schatz des Saarlandes ist nach Auffassung von Thomas Neu das Grubenwasser. Das Saarland „hat davon eine große Menge“ – angefangen vom Bergwerk Duhamel (Ensdorf) über die Schachtanlagen Reden, Camphausen, Viktoria (Püttlingen), Luisenthal bis hin zum Warndt. „Auch hier sind andere Regionen in Deutschland schon weiter.“ In Sachsen sei bereits im Jahr 2001 eine Studie zum Grubenwasser-Potenzial erstellt worden. Inzwischen seien acht Anlagen in Betrieb, eine in Planung und eine weitere werde derzeit umgesetzt. NRW habe im Jahr 2018 eine Potenzialstudie erstellt, in der sechs Vorhaben als erfolgversprechend identifiziert worden seien und teilweise schon in Betrieb sind (z. B. Alsdorf oder Bochum). „Die Studie stellt fest, dass in den Bergbauregionen von NRW erhebliche Potenziale zur Wärmegewinnung aus Grubenwasser bestehen, die einen wichtigen Beitrag zur Wärmewende leisten können.“ Auch das Saarland „muss einen solchen Masterplan erstellen, der darlegen soll, wie hierzulande das Grubenwasser zum Heizen von Wohn- oder Gewerbegebieten genutzt werden kann“. Die Bergbaugesellschaft RAG, die für die Wasserhaltung verantwortlich ist, „wird hier nichts tun. Die RAG will das Wasser in den alten Schächten auf minus 320 Meter ansteigen lassen. Anschließend soll es in Ensdorf aufbereitet und in die Saar geleitet werden.“ Dann sei für die RAG das Kapitel Grubenwasser abgeschlossen.
Es seien bereits Chancen vertan worden. Ein Erfolg versprechendes Projekt, bei dem Grubenwasser aus dem früheren Bergwerk Reden genutzt werden sollte, um den Gewerbepark Klinkenthal (Schiff weiler) mit Wärme zu versorgen, sei später nicht weiterverfolgt worden. Heute fließe das Wasser in den Klinkenbach und der Gewerbepark wird mit Erdgas und die Gebäude der früheren Grube Reden, in denen heute Landesbehörden untergebracht sind, werden mit Heizöl und Hackschnitzel beheizt. Lediglich in Camphausen werde derzeit Grubenwasser zum Heizen verwendet. „Eine Wärmepumpe nutzt dort die im Wasser enthaltene Restwärme von 36 Grad für die Fernwärme-Versorgung von Camphausen sowie des Sulzbacher Krankenhauses“, so Neu. Weitere Wärme, aber auch Strom liefert ein mit Grubengas betriebenes Blockheizkraftwerk (BHKW).
Doch der Druck auf die Städte und Gemeinden steige, die künftige Wärmeversorgung anzupacken, da Deutschland bis 2045 klimaneutral sein will. Bis Mitte 2028 „müssen alle Kommunen ihre Wärmepläne vorlegen, die Alternativen zum Heizen mit Öl und Gas aufzeigen.“ Hier könne die Geothermie einen entscheidenden Beitrag leisten. „Ein Drittel der Fernwärmeversorgung könnte bis 2045 von ihr übernommen werden.“
Lothar Warscheid