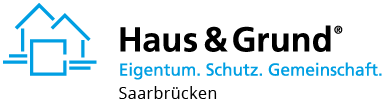Wärmewende
Investitionen zwischen Anspruch und Realität
Die Wärmewende im Gebäudebestand stellt private Vermieter vor erhebliche Herausforderungen. Die Vermieterbefragung 2025 von Haus & Grund Deutschland zeigt, dass Investitionen derzeit überwiegend in Form von Teilsanierungen erfolgen.
In fast der Hälfte der Mehrfamilienhäuser sowie der Ein- und Zweifamilienhäuser wurden in den vergangenen Jahren einzelne Gebäudebereiche wie Heizungen, Fenster oder die Gebäudehülle erneuert. Komplettsanierungen bleiben dagegen die Ausnahme. Der Grund liegt vor allem in praktischen und wirtschaftlichen Hürden: Eine umfassende energetische Modernisierung erfordert häufig einen vorübergehenden Leerstand des gesamten Hauses – eine Voraussetzung, die private Vermieter in der Regel nicht erfüllen können, da sie weder Ersatzwohnungen bereitstellen noch auf laufende Mieteinnahmen verzichten können.
Begrenzter Handlungsspielraum bei Eigentumswohnungen
Besonders deutlich wird die Problematik bei Eigentumswohnungen. Rund 70 Prozent davon wurden bislang nicht energetisch modernisiert. Der Grund ist, dass einzelne Wohnungseigentümer in Gemeinschaften oft nur sehr begrenzten Einfluss auf notwendige Investitionen haben. Die Befragung macht damit klar, dass energetische Erneuerung in diesen Fällen weniger an mangelnder Einsicht oder technischer Machbarkeit, sondern an strukturellen Rahmenbedingungen scheitert.
Akzeptanzproblem beim Gebäudeenergiegesetz
Ein zentrales Instrument der Klimapolitik ist das Gebäudeenergiegesetz (GEG). Es verlangt, dass neue Heizsysteme künftig zu mindestens 65 Prozent auf erneuerbaren Energien basieren. Ein Umfrageexperiment unter 2.600 privaten Immobilieneigentümern der Zeitschrift „Wirtschaftsdienst“ zeigt, dass das Gesetz bei privaten Eigentümern auf erhebliche Vorbehalte stößt. Zwar steigt das Wissen über die Inhalte des Gesetzes, wenn sachliche Informationen vermittelt werden. Dennoch halten nur rund 31 Prozent der Befragten das GEG für sinnvoll. Entscheidend ist nicht ein Informationsdefizit, sondern die Frage, ob die Vorgaben mit den Lebensrealitäten privater Eigentümer vereinbar sind. Wer den Klimaschutz als oberstes politisches Ziel betrachtet, bewertet das Gesetz eher positiv. Eigentümer, die stärker auf Wirtschaftlichkeit, Planungssicherheit und Entscheidungsfreiheit achten, bleiben dagegen skeptisch. Noch ausschlaggebender dürfte aber die technische Machbarkeit sein. Wer vor allem im Mehrfamilienhaussegment keine Möglichkeit für die technische Umsetzbarkeit sieht, wird dem Gesetz zwangsläufig ablehnend gegenüberstehen.
Kommunale Wärmeplanung zeigt bislang kaum Wirkung
Damit Eigentümer Investitionen in Heizsysteme sinnvoll planen können, braucht es eine verlässliche kommunale Wärmeplanung. Sie soll Orientierung geben, ob künftig ein Wärmenetz zur Verfügung stehen wird oder ob dezentrale Lösungen gefragt sind. Die Vermieterbefragung zeigt jedoch, dass hier noch großer Nachholbedarf besteht. Nur gut 8 Prozent der Vermieter wissen sicher, dass es in ihrer Kommune bereits eine Wärmeplanung gibt. Über die Hälfte verneint dies, ein weiteres Drittel ist gänzlich uninformiert. Dieses Ergebnis verwundert wenig, haben doch bis Mitte 2025 lediglich 5 Prozent der Kommunen eine kommunale Wärmeplanung abgeschlossen. In über der Hälfte ist der Planungsstand gar nicht bekannt. Entsprechend gering ist der Einfluss auf Investitionsentscheidungen. Lediglich 14 Prozent haben Maßnahmen wegen der Wärmeplanung verschoben, nur 4,5 Prozent bereits umgerüstet. Für zwei Drittel hatte die Planung bisher keinerlei Auswirkungen.
Investitionen bisher überwiegend in bewährte Systeme
Die bisherigen Investitionen spiegeln diese Unsicherheit wider. Fast 40 Prozent der Umrüstungen entfallen weiterhin auf neue Gasheizungen. Erneuerbare Einzeltechnologien wie Wärmepumpen oder Pelletsysteme erreichen zusammen nur etwa 20 Prozent, während Fernwärme auf gut 21 Prozent kommt. Hybride Systeme spielen mit unter 10 Prozent bislang nur eine Nebenrolle. Viele Eigentümer halten also an bewährten Lösungen fest – nicht aus Bequemlichkeit, sondern weil die Zukunftsfähigkeit alternativer Technologien für sie noch nicht ausreichend geklärt ist.
Fazit von Jakob Grimm, Referent für Wohnungs- und Stadtentwicklungspolitik:„Die Ergebnisse der Vermieterbefragung verdeutlichen, dass private Eigentümer keine Verhinderer der Energiewende sind. Doch damit die Wärmewende im Gebäudebestand gelingt, muss sie mit der Realität privater Vermieter in Einklang gebracht werden. Das GEG braucht mehr Praxistauglichkeit, die Wärmeplanung muss verlässlich und transparent ausgestaltet sein, und Sanierungen dürfen nicht nur gefordert, sondern müssen auch ermöglicht werden. Nur wenn politische Vorgaben wirtschaftlich tragfähig und verständlich sind, können Eigentümer die Wärmewende aktiv mitgestalten.“ |